Die pflegerische Versorgungsstruktur in Bayern
Die Zahl der im Freistaat lebenden pflegebedürftigen Menschen steigt. Viele werden zu Hause von Familienangehörigen und ambulanten Pflegediensten versorgt. Ergänzt wird das Angebot durch Pflegeheime und ambulant Betreute Wohngemeinschaften. Neue Konzepte und Versorgungsketten zielen darauf ab eine optimale Betreuung zu gewährleisten und dabei die Wünsche und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen in den Vordergrund zu stellen.
Strukturdaten
Das IGES Institut hat im Auftrag des StMGP im Herbst 2020 ein Pflegegutachten für Bayern erstellt, basierend auf den Zahlen der Pflegestatistik 2017. Die Pflege-Bedarfsprognosen wurden vom IGES Institut im Sommer 2021 anhand der Zahlen der Pflegestatistik 2019 und im Sommer 2023 anhand der Zahlen der Pflegestatistik 2021 angepasst beziehungsweise neu berechnet.
Entwicklung der pflegebedürftigen Personen in Bayern
Laut Gutachten zeigt die Bevölkerungsentwicklung in Bayern bis zum Jahre 2050 einen Anstieg der Einwohnerzahl auf 13,3 Mio. Personen im Jahre 2025, 13,4 Mio. Personen im Jahr 2030 und 13,5 Millionen Personen im Jahr 2040. Danach sinkt die Bevölkerungsgröße voraussichtlich wieder leicht auf 13,4 Millionen Personen im Jahr 2050. Die Anzahl der Personen ab einem Alter von 65 Jahren steigt besonders stark an: Im Jahr 2050 befinden sich in Bayern 2,2 Millionen Personen im Alter von 65 bis 79 Jahren und 1,4 Millionen Personen im Alter von 80 Jahren und älter.
Da die Prävalenz von Pflegebedarf ab dem Alter von etwa 75 Jahren stark ansteigt, ist zu erwarten, dass auch die Zahl der pflegebedürftigen Personen in Bayern deutlich zunehmen wird. Unabhängig von der alternden Bevölkerung gibt es aber auch eine große Zahl an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem zum Teil hohen Pflegebedarf. Die Zahl der bis 18-jährigen Pflegebedürftigen beläuft sich auf 27.092 und wird bis zum Jahr auf 26.315 etwas abfallen
Im Dezember 2021 waren in Bayern 578.147 Personen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes.
Neuen Prognosen des aktualisierten Pflegegutachtens zufolge könnte diese Zahl bis zum Jahr 2050 auf bis zu 1,1 Mio. Menschen ansteigen. Dies wäre beinahe eine Verdoppelung der Anzahl der Pflegebedürftigen in nur 29 Jahren.
Mit einem Plus von rund 18 Prozent seit der letzten Pflegestatistik aus dem Jahr 2019 ist ein hoher Gesamtzuwachs der Zahl der Personen mit Pflegebedarf gemäß SGB XI zu verzeichnen, der vollständig auf die zu Hause versorgten pflegebedürftigen Personen fällt.
Dabei dürfte der Wunsch nach einer Pflege zu Hause auch in Zukunft im Vordergrund stehen. Dies wird auch in der Pflegestatistik für das Jahr 2021 deutlich. Dort hat sich der Anteil der zu Hause lebenden Pflegebedürftigen in Bayern auf über 80 Prozent erhöht.

Langfassung herunterladen
Die Langfassung des IGES Gutachten „Pflege Bayern 2025-2050“ sowie die zugehörigen Anlagen 1 (07/2021) und 2 (06/2023) können aus unserer Download-Cloud heruntergeladen werden.
Die Zugangsdaten finden Sie im Download-Bereich.
Entwicklung der Pflegeplätze
Im Bereich der ambulanten Versorgung nahm sowohl die Zahl der Pflegedienste als auch deren Personal leicht zu. Die Zahl der von ambulanten Diensten Ende 2021 versorgten pflegebedürftigen Personen erhöhte sich bayernweit im Vergleich zu 2019 um rund 5 Prozent, wobei im Regierungsbezirk der Oberpfalz ein Rückgang von rund 1 Prozent zu verzeichnen war. Der größte Zuwachs ist im Regierungsbezirk Schwaben mit rund 7 Prozent festzustellen.Bis zum Jahr 2050 wird der Bedarf an ambulanten Sachleistungen laut Gutachten um 48 Prozent zunehmen.
Im teilstationären Bereich haben sich die Kapazitäten von 2019 bis 2021 um fast 25 Prozent (2.243 Plätze) erhöht. Ein überdurchschnittlicher Zuwachs war vor allem in Schwaben (+ 47 Prozent), der Oberpfalz (+ 37 Prozent) und Unterfranken (+ 35 Prozent) zu verzeichnen. Die niedrigste Zuwachsrate hatte Oberfranken mit rund 12 Prozent. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Für das Jahr 2050 wird ein Anstieg des Pflegeplatzbedarfs im Bereich der teilstationären Pflege um 7.278 auf 19.947 Pflegeplätze prognostiziert. Dies entspricht einer Steigerung um etwa 57 Prozent.
Im Bereich der vollstationären Pflege beläuft sich der Pflegeplatzbedarf im Jahr 2021 auf 127.581 Pflegeplätze. Bis zum Jahr 2050 erhöht sich der Bedarf an vollstationären Pflegeplätzen um 80.729 auf 208.310 Pflegeplätze. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 63 Prozent.
Nach wie vor weisen nur wenige Landkreise beziehungsweise kreisfreien Städte eine ausreichende Versorgung mit Kurzzeitpflegeplätzen auf und es wird immer schwieriger, eine adäquate Versorgung zu finden, insbesondere für Personen mit besonderen pflegerischen Bedarfen. Der prognostizierte Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen steigt von 2.625 im Jahr 2021 auf bis zu 4.273 Pflegeplätze im Jahr 2050.
In ganz Bayern wird in allen Versorgungsarten ein starker Anstieg des Pflegeplatzbedarfs prognostiziert.
In Oberbayern erhöht sich der Pflegeplatzbedarf im Bereich der vollstationären Dauerpflege um 67 Prozent, der Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen und teilstationären Pflegeplätzen steigt innerhalb des Prognosezeitraums bis zum Jahr 2050 um 58 bis 60 Prozent.
Der größte Bedarfsanstieg wird voraussichtlich Bedarf in Niederbayern erwartet: Hier erhöht sich der Pflegeplatzbedarf im vollstationären Bereich um 72 Prozent und im teilstationären Bereich sogar um 85 Prozent bis zum Jahr 2050.
Für den Regierungsbezirk Oberfranken werden aufgrund der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung insgesamt die niedrigsten Zuwachsraten beim Pflegeplatzbedarf erwartet. Hier wird sich der Pflegeplatzbedarf im Bereich der vollstationären Dauerpflege um 50 Prozent erhöhen und der Bedarf an teilstationären Pflegeplätzen innerhalb des Prognosezeitraums bis zum Jahr 2050 laut Gutachten um 46 Prozent ansteigen.
Entwicklung der Pflegekräfte
Im Jahr 2021 sind in Bayern 89.224 Pflegekräfte (Vollzeitäquivalenten) in der Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen Personen beschäftigt, davon 43.458 Pflegefachkräfte und 45.766 Pflegehilfskräfte. Im Basisszenario des Gutachtens erhöht sich der Personalbedarf in der Langzeitpflege bis zum Jahr 2050 um insgesamt 53.328 Pflegekräfte auf 142.551 Pflegekräfte, jeweils in Vollzeit gerechnet. Der Bedarfsanstieg setzt sich aus 25.829 Pflegefachkräften und 27.498 Hilfskräften zusammen.
Für die pflegerische Versorgung pflegebedürftiger Personen von besonderer Bedeutung ist die Entwicklung des Bedarfs an Pflegefachkräften. In Oberbayern, dem größten Regierungsbezirk, erhöht sich der Fachkräftebedarf bis 2050 voraussichtlich um 7.965 Pflegefachkräfte (in Vollzeit). Das entspricht einer Zuwachsrate von etwa 62 Prozent. Die höchste relative Bedarfssteigerung bei Pflegefachkräften ist mit 72 Prozent für Niederbayern zu erwarten. Dort beläuft sich der Fachkräftemehrbedarf im Jahr 2050 auf 3.315 Pflegefachkräfte im Vergleich zu 2021. Dagegen fällt die Bedarfsentwicklung in Oberfranken mit 46 Prozent am niedrigsten aus, gefolgt von Unterfranken und Mittelfranken mit Zuwachsraten von 53 Prozent beziehungsweise 56 Prozent.
Das wichtigste Ziel ist und bleibt es, die Pflege sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich, auf hohem Niveau zu sichern.
Dies gilt für die pflegerische Versorgung in allen bayerischen Regionen, einschließlich dem ländlichen Raum. Gerade im ländlichen Raum sind dabei in der Regel keine großen Pflegeheime erforderlich. Zielführend können kleine, abgestufte pflegerische Arrangements sein, wie z. B. die Ansiedlung einer Begegnungsstätte, einer Tagespflegeeinrichtung und einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft in einem Gebäude. Hier haben sich bereits einige Gemeinden auf den Weg gemacht und gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern Lösungen entwickelt (Steckbriefe der guten Ideen – Nachahmung erwünscht: Projektdatenbank – Koordinationstelle Pflege und Wohnen in Bayern). Die für die Schaffung und Modernisierung erforderlichen Investitionen, werden seitens des StMGP mit der Förderrichtlinie PflegesoNah unterstützt. Unabhängig davon, lässt sich dieses Ziel nur gemeinsam mit allen Beteiligten in der Pflege verwirklichen.
Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände und dem Landesamt für Pflege wurde vom StMGP die Strategie „Gute Pflege. Daheim in Bayern.“ entwickelt. Mit einem ganzen Maßnahmenbündel werden gemeinsam bedarfsgerechte pflegeorientierte Strukturen gestärkt und auch neue Strukturen geschaffen.
Wohnen im sozialen Nahraum
„Ambulant vor stationär“ als Grundsatz beim Aufbau neuer Angebote.
Der Wunsch nach Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Sicherheit im direkten Wohnumfeld wird für Pflegebedürftige zunehmend bedeutsam. Um diesen Wunsch erfüllen zu können werden bedarfsgerechte und sozialraumorientierte Angebote benötigt. Diese Angebote müssen diverse Aspekte miteinander verbinden; Wohnen, soziale Kontakte, Betreuung, haushaltsnahe Dienstleistungen, Ernährung und Pflege.
Der Soziale Nahraum ist, über die Wohnung hinaus das Wohnumfeld, in dem Menschen ihr tägliches Leben gestalten, sich versorgen und ihre sozialen Kontakte pflegen. Dazu zählt beispielsweise das Dorf, die Gemeinde oder der Stadtteil in dem jemand lebt.
Sogenannte Quartierskonzepte zielen darauf ab, den „sozialen Nahraum“ so zu gestalten, dass auch pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können. Die Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte der jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte bilden hierfür eine gute inhaltliche Grundlage.
„Gemeindeschwester“-Projekte im sozialen Nahraum
Pflege geschieht vor Ort. Lokale oder interkommunale pflegerische Quartierskonzepte setzen genau hier an und stärken auch den vom Wegzug erwerbstätiger Personen und demographischem Wandel geschwächten, ländlichen Raum. Konzepte, die den nachbarschaftlichen Vernetzungsgedanken für die Versorgung Pflegebedürftiger in besonderer Weise umsetzen oder Ergänzungen bereits bestehender Quartierskonzepte um Aspekte der Pflege beinhalten, setzen hier individuell und passgenau an.
Mit Start im Jahr 2020 und einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren wurden zwei Modellprojekte im ländlichen Raum und ein weiteres im städtischen Bereich durchgeführt. Ziel aller drei Projekte war es, die Bedeutung von „Gemeindeschwester“-Modellen für die pflegerischen Versorgungsstrukturen vor Ort in der Praxis zu prüfen und Aussagen zur Übertragbarkeit auf andere ländliche und städtische Regionen zu generieren. Insgesamt wurden die drei Projekte und deren wissenschaftliche Begleitung mit rund 676.000 Euro gefördert. Die Auswertung der Projekte dauert noch an.
Die Erprobung und die wissenschaftliche Evaluation dieser Projekte soll helfen, die pflegerische Versorgungsstruktur im jeweiligen sozialen Nahraum sukzessive zu verbessern, generalisierbare Handlungsempfehlungen abzuleiten und so im nächsten Schritt die Ausweitung dieser Projekte bayernweit dauerhaft voranzubringen. In Bayern stellen die 2.089 Pflegeheime im Wohnviertel ein großes Potential dar. Sie könnten sich zu Pflegekompetenzzentren weiterentwickeln. Hier könnte ein bedarfsgerechter Versorgungsmix bestehend aus stationärer Pflege, Tagespflege, alternativen oder betreuten Wohnformen, und ambulanter Pflege und Betreuung aufgebaut werden. Des Weiteren sind gute Beratung und die Anbindung von örtlichen Nachbarschaftsinitiativen und Vereinen wichtige Bausteine.
Die Pflegestärkungsgesetze (PSG) I und II stärken ambulante Angebote. Stationäre Pflegeanbieter erweitern, dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ folgend ihr Leistungsportfolio um ambulante Pflege. Wichtig beim Aufbau neuer Angebote ist die Beteiligung der Kommunen. Ihre Rolle als Planer von Beratungsstrukturen, als Gestalter nötiger Infrastruktur und Förderer der Vernetzung verschiedener Akteure wurde durch das PSG II gestärkt.
„Pflege aus einer Hand“ ist eine Möglichkeit. Hierbei bietet ein Träger alle Formen der Pflege an. Möglich ist aber auch eine aufeinander abgestimmte Kooperation zwischen einzelnen Leistungserbringern.

Pflegefinder Bayern – Die digitale Börse für pflegerische Angebote
Die Suche nach freien, passenden und örtlich günstig gelegenen Pflegeplätzen oder pflegerischen Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige, deren Angehörige und Betreuer gestaltet sich in Bayern aktuell zeitaufwändig und anstrengend, da zum Mangel an Plätzen dazu keine flächendeckenden, digitalen Suchmöglichkeiten vorhanden sind. Mit dem Pflegefinder Bayern wollen wir die Suche nach Pflegeplätzen, pflegerischen Angeboten und anderen unterstützenden Leistungen stark vereinfachen und so auch die häusliche Pflege stärken.
Auch die Anbieter von pflegerischen Hilfen und Unterstützungsleistungen sollen von der Einführung der Plattform profitieren, ihnen soll mit Teilnahme und Nutzung das Anfragemanagement stark vereinfacht werden. Wir gehen hier von einer spürbaren Entlastung im Arbeitsalltag aus, mit einem Zeitgewinn, der wiederum Entlastung in der täglichen Arbeit bedeutet.
Im März 2023 erfolgte der offizielle Startschuss für die Entwicklung, Implementierung und den Betrieb der Plattform, seit 1. Januar 2024 steht der Pflegefinder den Bürgerinnen und Bürgern unter www.pflegefinder.bayern zur Verfügung
Die Entwicklung und der Betrieb werden vom StMGP über eine Laufzeit von insgesamt sechs Jahren mit rund 293.000 Euro gefördert.
Heimentgelt und Förderung von Investitionskosten in Pflegeheimen
Wenn ein Umzug in ein Pflegeheim im Raum steht, stellen sich für die künftige Bewohnerin oder den künftigen Bewohner und Angehörige viele Fragen. Einige davon betreffen vor allem Themen zur Finanzierung der Heimkosten. Wie lassen sich die Kosten finanzieren? Wo liegen finanzielle Unterschiede? Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Das monatliche Heimentgelt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:
Kosten und Unterstützung
Für Personen, die wegen der Unterbringung in einem Pflegeheim auf Leistungen nach dem SGB XII oder der Kriegsopferfürsorge angewiesen sind, greifen spezielle Regelungen.
Wenn die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und die Investitionskosten nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen gedeckt werden können, kann Unterstützung beantragt werden. Im Rahmen der „Hilfe zur Pflege“ können Kosten (teilweise) übernommen werden. Beantragt werden kann diese Unterstützung bei den bayerischen Bezirken.
Die Kosten für die Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung können stark schwanken. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der Auswahl eines Heims über alle anfallenden Kosten, einschließlich der Investitionsaufwendungen, ausführlich beraten zu lassen.
Hilfestellung und Beratung bieten Ihnen unter anderem die Pflegestützpunkte in Bayern, die Seniorenämter und Seniorenbeauftragten der Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Pflegedatenbanken der Krankenkassen.
Die Pflegenavigatoren der Pflegekassen, z.B. der AOK Bayern, bieten die Möglichkeit gezielt nach Adress-, Preis- und Zusatzdaten zu suchen.
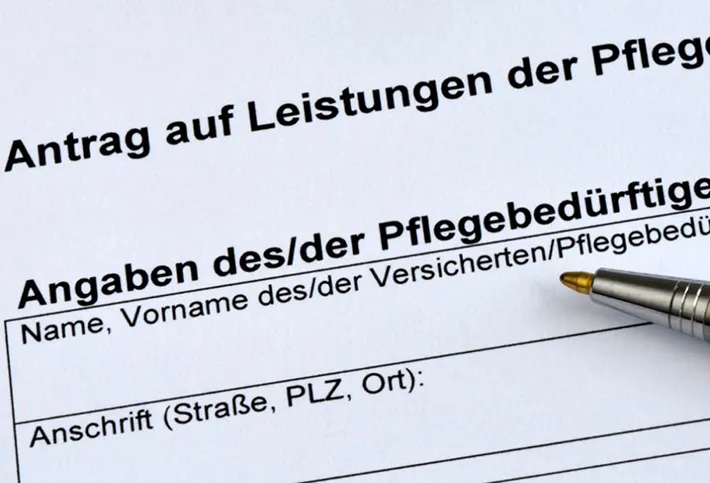
Investitionskostenförderung
Angesichts der weiter ansteigenden Zahl an pflegebedürftigen Menschen ist es enorm wichtig, die Entstehung von pflegerischen Angeboten zu unterstützen. Das Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention begleitet daher den Ausbau der pflegerischen Versorgungsstrukturen mit einem eigenen Förderprogramm. Die Förderung von Pflegeplätzen im Rahmen der Förderrichtlinie „Pflege im sozialen Nahraum – PflegesoNahFöR“ unterstützt und entlastet seit 2019 die häusliche Pflege.
So wird der Ausbau von Angeboten wie Begegnungsstätten für Pflegebedürftige, Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeplätzen gefördert. Mit Fördermöglichkeiten bei der Errichtung ambulant betreuter Wohngemeinschaften soll sie insbesondere im ländlichen Raum Pflege vor Ort ermöglichen und erleichtern. Zudem können hierüber Dauerpflegeeinrichtungen gefördert werden. Dabei erhalten diese eine höhere Fördersumme, wenn sie sich mit ihren Angeboten in den sozialen Nahraum öffnen. Unter sozialem Nahraum ist das Wohnumfeld, über die Wohnung hinaus zu verstehen, in dem Menschen ihr tägliches Leben gestalten, sich versorgen und ihre sozialen Kontakte pflegen. Mit den Angeboten in diesem Bereich werden Pflegebedürftige und Pflegende im direkten Umfeld der Einrichtung unterstützt und die geförderten Einrichtungen leisten einen wichtigen Beitrag zur gelingenden Pflege zu Hause. Neu in die Förderrichtlinie aufgenommen wurde die Förderung von Plätzen der Verhinderungspflege und palliativen Pflege, denn auch in diesem Bereich ist der Bedarf groß.
Soll ein Bauvorhaben in ein Förderprogramm aufgenommen werden, muss bis spätestens 31. Oktober eines jeden Jahres ein vollständiger Förderantrag beim Landesamt für Pflege in Amberg vorliegen, damit er in das Auswahlverfahren einbezogen werden kann.
Nähere Informationen zur Förderrichtlinie PflegesoNah, Kontaktdaten und die Fördervoraussetzungen stehen hier zur Verfügung:
Modellprojekt im Rahmen der Verhinderungspflege – Seniorenhaus Euerdorf
Anlässlich des neuen Fördertatbestands der Verhinderungspflege wird aktuell der Betrieb einer Pflegewohnung mit dem Angebot an Plätzen für die Verhinderungspflege im Rahmen eines Modellprojekts wissenschaftlich begleitet. Dabei handelt es sich um das Seniorenhaus Euerdorf der Carl von Heß Sozialstiftung Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die evangelische Hochschule Nürnberg.
Konkret geht es um die Schaffung von Angeboten der Verhinderungspflege, also die Sicherstellung der Betreuung von Pflegebedürftigen, wenn die Pflegeperson z. B. wegen Erkrankung ausfällt. Der Ausbau dieser Angebote ist sehr wichtig, da sie über eine bestimmte Zeit eine große Entlastungsmöglichkeit für pflegende Angehörige bieten und Ersatzpflege zuhause oftmals nicht möglich ist. Durch die Förderung soll ein wichtiger Anreiz für die Schaffung und Etablierung von so genannten „Pflegewohnungen“ entstehen, das heißt dauerhaft Angebote schaffen für:
- eine befristete Pflegezeit
- mit flexibel buchbaren Leistungen (Wahlleistungen)
- angelehnt an die eigene Häuslichkeit
- ortsnah und im sozialen Nahraum
Weitere Informationen zu dem Fördertatbestand finden Sie im Merkblatt des Landesamts für Pflege (PDF, 155KB).
Das Seniorenhaus Euerdorf bietet seine Leistungen seit April 2023 an. Umfangreiche Informationen zu dem Angebot, Kontaktdaten sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten Sie hier:
Mehr erfahren
Das könnte Sie interessieren
Rechtsgrundlagen
Weitere Informationen

Pflege-SOS-Hotline
Die Anlaufstelle Pflege-SOS Bayern hilft vor allem bei Beschwerden zur pflegerischen Versorgung in stationären Einrichtungen.

