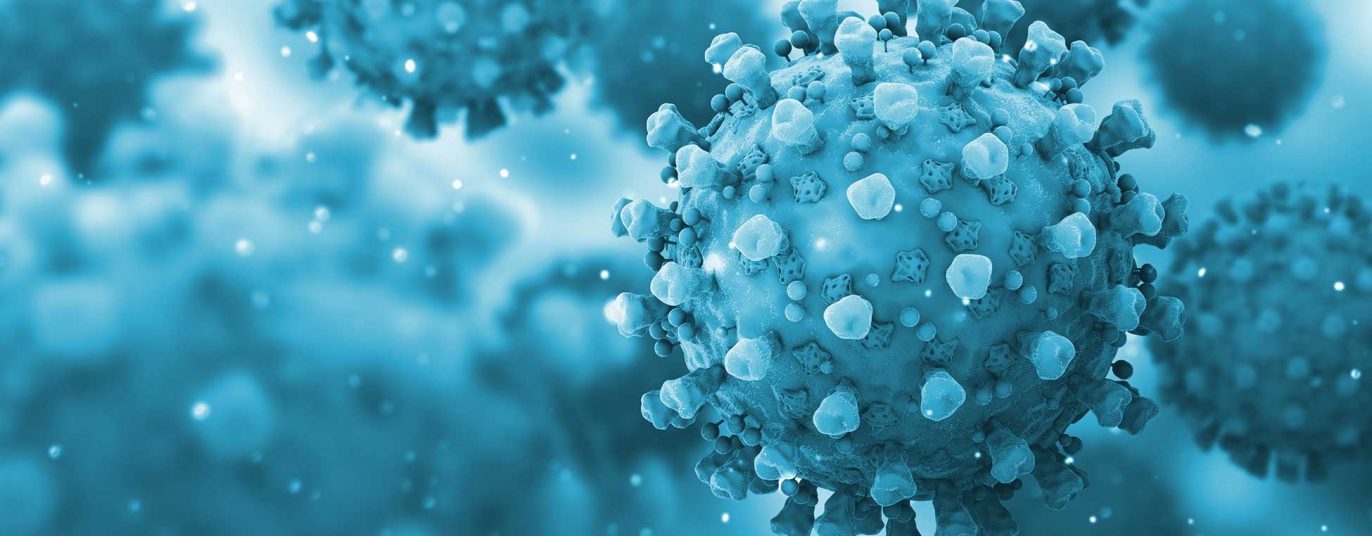
Infektion
Das Coronavirus verbreitet sich über Tröpfchen und Aerosole aus den Atemwegen. Trotz Einhaltung aller Schutzmaßnahmen und Impfung wird sich eine Ansteckung nicht immer vermeiden lassen. Hier finden Sie Informationen darüber, welche Verhaltensempfehlungen im Fall einer Ansteckung zu beachten sind.
- Wie bei anderen akuten Atemwegserkrankungen gilt auch bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 die Empfehlung: Wer Symptome hat und krank ist, bleibt daheim, um andere nicht anzustecken!
- Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt, den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Telefonnummer 116 117 oder in Notfällen an den Notruf unter 112.

Positiv getestet oder Kontaktperson? Das ist zu tun!
In diesen Handlungsleitfäden informieren wir über Verhaltensempfehlungen und Hygiene:
Positiver Test – Antworten auf häufige Fragen
Ich bin positiv getestet – welche Verhaltensempfehlungen gelten für mich?
Seit dem 1. März 2023 gelten in Bezug auf Personen, die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden, keine verpflichtenden, staatlich angeordneten Schutzmaßnahmen mehr.
Positiv getesteten Personen wird jedoch weiterhin empfohlen, sich freiwillig in Selbstisolation zu begeben, ihrer beruflichen Tätigkeit, soweit möglich, von der eigenen Wohnung aus nachzugehen, unnötige Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden und auf den Besuch öffentlicher Veranstaltungen sowie der Gastronomie zu verzichten. Für die Dauer der Infektion wird weiterhin empfohlen, die allgemein gültigen Verhaltensempfehlungen zur Infektionsprävention insbesondere die AHA+L Regeln einzuhalten und bei Kontakt zu anderen Personen – insbesondere in Innenräumen und bei Nicht-Einhaltung von Mindestabständen – mindestens eine medizinische Gesichtsmaske, bevorzugt jedoch eine FFP2-Maske, zum Schutz aller Beteiligten zu tragen.
Wie bei anderen akuten Atemwegserkrankungen gilt auch bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 die Empfehlung: Wer krank ist, bleibt daheim, um andere nicht anzustecken. Sollten Sie ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt.
Für weitere Informationen werfen Sie einen Blick in den Handlungsleitfaden „Positiver Test – was ist zu tun?“ (PDF, 158 KB)
Wer sollte informiert werden?
Wenn Sie positiv auf Corona getestet wurden, informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen. Auch diese sollten aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos eigenverantwortlich vorsorglich ihre Kontakte soweit möglich reduzieren und sich testen.
Falls Sie Kontakt zu Personen haben, die in Einrichtungen arbeiten, in denen Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe einer COVID-19-Erkrankung behandelt oder betreut werden, informieren Sie diese bitte ebenfalls.
Kontakt zu einer infizierten Person – was ist zu tun?
Um Ansteckungen zu verhindern und Infektionsketten zu unterbrechen, leistet Ihr eigenverantwortliches Handeln einen entscheidenden Beitrag.
Näheres erfahren im Handlungsleitfaden Kontakt zu einer infizierten Person – Was ist zu tun? (PDF, 147 KB).
Beschäftigte, die mit vulnerablen Personengruppen arbeiten, beachten bitte ihre einrichtungsinternen Hygienepläne.
Welche Empfehlungen gelten bei einem positiven Selbsttest?
Für alle Personen, die bei einem Selbsttest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 ein positives Ergebnis erhalten, gilt: Sie sollten sich nach Möglichkeit freiwillig isolieren und Kontakte zu anderen Menschen vermeiden, denn es besteht der Verdacht, dass Sie ansteckend sind. Für die Dauer der Infektion wird weiterhin empfohlen, die allgemein gültigen Verhaltensempfehlungen zur Infektionsprävention insbesondere die AHA+L Regeln einzuhalten. Tragen Sie mindestens eine medizinische Maske, bevorzugt eine FFP2-Maske, in geschlossenen Räumen und an Orten, an denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.
Sollte sich Ihr Gesundheitszustand verschlechtern oder anderweitig ärztliche Hilfe nötig sein, verständigen Sie bitte Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt, den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns unter der Telefonnummer 116 117 oder gegebenenfalls den Notarzt. Weisen Sie beim Anruf unbedingt darauf hin, dass Ihr Selbsttest positiv war.
Welche Hygieneregeln neben Abstandhalten, Lüften und Maskentragen sind wichtig?
Zusätzlich zum Abstandhalten und dem Maskentragen dienen folgende Hygieneregeln dem Schutz vor Infektionen.
Husten und Niesen mit Rücksicht:
- Halten Sie größtmöglichen Abstand zu anderen Personen, mindestens 2 Meter.
- Drehen Sie sich beim Husten und Niesen von anderen Personen weg.
- Husten und niesen Sie zum Schutz anderer in die Armbeuge oder in ein Einweg-Taschentuch und entsorgen Sie es umgehend in einem verschließbaren Mülleimer mit einem Müllbeutel. Der Müllbeutel ist später verschlossen in den Restmüll zu geben.
Händehygiene:
- Verzichten Sie auf das Händeschütteln oder Handhalten mit anderen Personen.
- Waschen Sie regelmäßig und gründlich Ihre Hände mit Wasser und Seife für mindestens 20 bis 30 Sekunden, insbesondere
- nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten,
- vor der Zubereitung von Speisen,
- vor dem Essen,
- nach dem Toilettengang,
- immer dann, wenn die Hände sichtbar schmutzig sind,
- vor und nach jedem Kontakt zu anderen Personen und vor allem nach jedem Kontakt mit einer möglicherweise erkrankten Person oder deren unmittelbarer Umgebung.
Händedesinfektionsmittel können Sie bei nicht sichtbarer Verschmutzung benutzen. Achten Sie dabei auf die Bezeichnung des Desinfektionsmittels mit nachgewiesener Wirksamkeit „begrenzt viruzid“.
Was ist zu tun bei einem positiven Test bei Schülerinnen oder Schülern oder bei Kindern, die die Kita besuchen?
Generell gilt die Empfehlung: Wer krank ist, bleibt zuhause.
Wo finden sich Informationen zu Entschädigung bei Verdienstausfall aufgrund der Corona-Pandemie?
Informationen rund um die Erstattungsmöglichkeiten und Elternhilfe finden Sie weiter unten auf dieser Seite unter Entschädigung bei Verdienstausfall aufgrund der Corona-Pandemie.
Impfen gegen das Coronavirus
Das Coronavirus SARS-CoV-2 zirkuliert auch weiterhin in der Bevölkerung. Durch die weniger schwer verlaufenden Omikron-Varianten und die hohe Immunität in der Bevölkerung durch Impfungen und Infektionen sind schwere Verläufe einer COVID-19-Erkrankung und Langzeitfolgen deutlich seltener geworden. Aber insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen haben weiterhin ein erhöhtes Risiko schwer an COVID-19 zu erkranken oder zu versterben.
Deshalb bleibt der beste Schutz vor schweren Verläufen einer Corona-Infektion nach wie vor die COVID-19-Impfung.
Weitere Ziele der Impfung sind die Reduktion von möglichen Langzeitfolgen von SARS-CoV-2-Infektionen in der Bevölkerung und die Entlastung des Gesundheitssystems.
Wer sollte sich impfen lassen?
Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut empfiehlt allen Personen ab 18 Jahren eine Basisimmunität bestehend aus drei SARS-CoV-2-Antigenkontakten (Impfung oder Infektion, davon mindestens eine Impfung). Auch Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren, die aufgrund einer Grundkrankheit ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf haben, Frauen im gebärfähigem Alter und Schwangeren wird eine Basisimmunität empfohlen.
Für gesunde Säuglinge, (Klein-)Kinder und Jugendliche empfiehlt die STIKO derzeit keine COVID-19-Impfung.
Folgenden Personengruppen empfiehlt die STIKO eine Basisimmunität und zusätzlich jährlich im Herbst eine Auffrischungsimpfung:
- Personen im Alter ab 60 Jahren
- Bewohnende in Einrichtungen der Pflege und Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
- Personen ab dem Alter von 6 Monaten mit einer Grundkrankheit, die mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf einhergeht.
- Personen jeden Alters mit einem erhöhten arbeitsbedingten Infektionsrisiko in der medizinischen bzw. pflegenden Versorgung mit direktem Kontakt zu Patientinnen und Patienten oder Bewohnenden
- Familienangehörige und enge Kontaktpersonen ab dem Alter von 6 Monaten von Personen, bei denen nach einer COVID-19-Impfung keine schützende Immunantwort zu erwarten ist.
Gesunden Erwachsenen unter 60 Jahre sowie gesunden Schwangeren werden bei bestehender Basisimmunität derzeit keine jährlichen Auffrischungsimpfungen empfohlen.
Die aktuelle Impfempfehlung der STIKO mit der wissenschaftlichen Begründung finden Sie auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts (Stand: 11.01.2024, nicht barrierefrei).
Impfreaktionen und Nebenwirkungen sind möglich
Vor der Impfung wird jede Patientin und jeder Patient eingehend von einer Ärztin, einem Arzt, einer Apothekerin oder einem Apotheker aufgeklärt, um die individuellen Risiken einzuschätzen und eine informierte Impfentscheidung treffen zu können. Unmittelbar nach der Impfung erfolgt eine routinemäßige Nachbeobachtung.
Wie bei jeder Impfung kann es auch nach der Corona-Schutzimpfung zu kurzfristigen Reaktionen kommen, die in der Regel nach wenigen Tagen komplett abklingen (Impfreaktionen). Es handelt sich hier um einen Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff und zeigt an, dass das Immunsystem mobilisiert wurde.
Eine Impfkomplikation beziehungsweise Impfnebenwirkung dagegen ist eine seltene, über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende, Folge einer Impfung. Der Verdacht auf eine solche unerwünschte Wirkung ist nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) meldepflichtig, unter anderem durch die Ärzteschaft. Die Meldepflicht ist somit auch Teil der kontinuierlichen Überwachung eines Arzneimittels beziehungsweise Impfstoffs nach der Zulassung. Die dafür zuständige Bundesbehörde ist das Paul-Ehrlich-Institut.
Wichtig zu wissen: Durch die Impfung bedingte, anhaltende Gesundheitsstörungen kommen insgesamt nur sehr selten vor, sodass der Nutzen einer Impfung bei weitem die Risiken überwiegt!
Hotline des LGL zum Thema „Post-Vac“
-
09131 6808 7878
-
Servicezeiten
-
Montag bis Freitag: 9 – 13 Uhr
-
Donnerstag: 14 – 18 Uhr
-
Hinweis: Die Post-Vac-Hotline wird zum 31. Oktober 2023 eingestellt!
Häufig gestellte Fragen bei gesundheitlichen Beschwerden nach einer COVID-19-Impfung
Ich habe Angst vor Impfschäden!
Ihre Gesundheit steht an erster Stelle! Schwerwiegende Nebenwirkungen nach Impfungen sind sehr selten. Lassen Sie sich gerne von der Ärztin bzw. dem Arzt Ihres Vertrauens zu allen Fragen rund um die COVID-19-Impfung aufklären und individuell beraten. Die verfügbaren COVID-19-Impfstoffe schützen gut vor einer schweren COVID-19-Erkrankung.
Ich habe Beschwerden nach einer COVID-19-Impfung, wie soll ich das einordnen?
Gesundheitliche Reaktionen auf eine verabreichte Impfung können in drei Kategorien eingeteilt werden: Impfreaktionen, Impfkomplikationen und Impfschäden.
Impfreaktion:
Wie bei jeder Impfung kann es auch nach der COVID-19-Impfung zu kurzfristigen Impfreaktionen kommen. Bei diesen Reaktionen handelt es sich um einen Ausdruck der erwünschten Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff. Diese zeigen an, dass das Immunsystem mobilisiert wurde. Die typischen Beschwerden nach einer Impfung können sich lokal äußern (z.B. Schmerzen und Rötung an der Einstichstelle) oder systemisch (z.B. Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und in manchen Fällen Fieber) und klingen in der Regel nach wenigen Tagen komplett ab.
Impfkomplikationen:
Schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkungen nach Impfungen sind sehr selten. Der Verdacht auf eine unerwünschte Wirkung, die über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgeht, ist nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig, unter anderem durch die Ärzteschaft. Das Melden von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen ist eine zentrale Säule für die Beurteilung der Sicherheit von Arzneimitteln. So können zeitnah neue Signale detektiert und das Nutzen-Risiko-Profil der Impfstoffe kontinuierlich überwacht werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch Reaktionen in zeitlicher Nähe zu einer Impfung nicht unbedingt im ursächlichen Zusammenhang mit einer Impfung stehen müssen. Die Meldepflicht ist Teil der kontinuierlichen Überwachung eines Arzneimittels beziehungsweise Impfstoffs nach der Zulassung. Die für die Arzneimittelsicherheit von Impfstoffen zuständige Bundesbehörde ist das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Nicht nur Beschäftigte in Gesundheitsberufen, auch jede geimpfte Person oder ihre Angehörigen können Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen nach Impfung mit einem COVID-19-Impfstoff unter anderem online melden unter https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/home/home_node.html.
Das PEI veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsberichte zu den COVID-19-Impfstoffen, in denen über die Meldungen über die Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen seit Beginn der COVID-19-Impfungen in Deutschland berichtet wird.
Impfschaden:
Ein sogenannter Impfschaden ist die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung.
Kann die COVID-19-Impfung den Herzmuskel schädigen?
Nach Gabe von COVID-19-mRNA-Impfstoffen zur Grundimmunisierung wurden sehr seltene Fälle von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen (Myokarditis und Perikarditis) beobachtet. Diese Fälle traten hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung, häufiger nach der 2. Impfstoffdosis (im Vergleich zur 1. Impfstoffdosis) und häufiger bei Jungen und jüngeren Männern auf. Die meisten Fälle dieser Herzmuskel- bzw. Herzbeutelentzündungen verliefen mild bis moderat, bei einem kleinen Teil der Betroffenen kam es jedoch zu schwere Verlaufsformen und in sehr wenigen Einzelfällen zu Todesfällen.
Wichtig zu wissen: Auch bei Infektionen mit dem Coronavirus können Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen auftreten!
Was wird unter dem sogenannten „Post-Vac-Syndrom“ verstanden?
Unter dem Post-Vac-Syndrom wird ein verschiedenartiges Krankheitsbild zusammengefasst, das in unterschiedlichem Abstand zur COVID-19 Impfung auftritt. Mögliche Ursachen und zugrundeliegende Wirkmechanismen des Post-Vac-Syndroms sind derzeit Bestandteil der wissenschaftlichen Forschung und Diskussion. Die Symptome werden als Long-COVID-ähnlich, wie etwa Erschöpfungssyndrom (Myalgische Enzephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome = ME/CFS) oder Multisystemisches Entzündungssyndrom (MIS-C, PIMS) beschrieben. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte sich im September 2022 in einem Sicherheitsbericht und im Mai 2023 in einer Stellungnahme zum Post-Vac-Syndrom geäußert und bekräftigt, dass eine intensive Überwachung entsprechender Verdachtsmeldungen durch das PEI erfolgt und das Post-Vac-Syndrom im Rahmen von weiteren Studien erforscht werden soll.
Wohin kann ich mich bei Beschwerden nach COVID-19-Impfung wenden oder wenn ich den Verdacht habe, unter dem „Post-Vac-Syndrom“ zu leiden?
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie nach der COVID-19-Impfung unter anhaltenden gesundheitlichen Störungen leiden, können Sie die bereits etablierten Versorgungsstrukturen nutzen. Als erster Ansprechpartner gilt in der Regel Ihre Hausarztpraxis.
Ihre Hausärztin bzw. Ihr Hausarzt führt meist die erste Diagnostik durch, veranlasst weitere fachärztliche Untersuchungen anderer Spezialgebiete, sammelt Befunde, dokumentiert den Verlauf Ihrer Beschwerden und ist Lotse und Ratgeber für die weiteren vorzunehmenden Schritte. Seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) wurde deshalb bereits im Sommer 2021 ein Long-COVID-Netzwerk Bayern (LoCoN) gegründet. Ziel ist der Aufbau eines breitgefächerten Netzwerkes aus haus- und fachärztlicher sowie psychotherapeutischer Expertise in Bayern, das die Basisversorgung der Bürger sichert. Zur Nutzung dieses Netzwerkes stellt Ihr Hausarzt bzw. Ihre Hausärztin ebenfalls die erste Ansprechstelle dar.
Für schwere Fälle sehen Experten Post-COVID-/ Long-COVID-Ambulanzen als gute Ansprechpartner für Diagnostik und Therapie für Patienten mit vermuteten „Post-Vac-Syndrom“ an. Der Freistaat verfügt hier über ein umfangreiches Netz an Anlaufstellen über die Post-COVID-/ Long-COVID-Ambulanzen.
Wo kann ich bei Verdacht auf einen Impfschaden Versorgungsleistungen beantragen?
Wer infolge einer öffentlich empfohlenen Schutzimpfung eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, die über das übliche Ausmaß einer Reaktion auf eine Schutzimpfung (Impfreaktion) hinausgeht, hat gemäß § 24 Sozialgesetzbuch XIV (SGB XIV) Anspruch auf Leistungen der Sozialen Entschädigung, sofern die weiteren Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 SGB XIV vorliegen (sog. Impfschaden).
In Bayern ist für die Bearbeitung entsprechender Anträge das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) zuständig. Das ZBFS prüft den Fall und beurteilt, ob ein Impfschaden vorliegt und damit Anspruch auf Leistungen besteht.
Wie wird geprüft, ob ein Impfschaden vorliegt?
In Bayern ist das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) für die Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung von Impfschäden zuständig. Das ZBFS ist die zentrale Landesbehörde im Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS).
Erforderlich für eine Anerkennung als Impfschaden ist dabei eine dreigliedrige Kausalkette:
- Das schädigende Ereignis, beispielsweise in Form einer öffentlich empfohlenen Schutzimpfung,
- eine darauf beruhende gesundheitliche Schädigung, die über das übliche Ausmaß einer Reaktion auf eine Schutzimpfung hinausgeht, und
- eine dadurch bedingte gesundheitliche und/oder wirtschaftliche Folge (sogenannter Impfschaden).
Gemäß § 4 Abs. 4 SGB XIV genügt zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Schädigungsfolge die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs. Sie ist gegeben, wenn nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft mehr für als gegen einen ursächlichen Zusammenhang spricht.
Wenn nach Prüfung des Einzelfalls ein Kausalzusammenhang besteht (der über ein rein zeitliches Zusammentreffen zwischen der Impfung und dem Auftreten einer gesundheitlichen Störung hinausgeht), werden die Schädigungsfolgen nach § 5 SGB XIV beurteilt und ein Grad der Schädigungsfolgen (GdS) festgelegt. Vorübergehende Gesundheitsstörungen (bis zu sechs Monaten) sind nicht zu berücksichtigen. Der festgestellte GdS ist dann Grundlage für die zustehenden Leistungen.
Beendigung der Zertifikatsausstellung und CovPass-App zum 31.12.2023
Aufgrund der im Sommer 2023 ausgelaufenen EU-Verordnung über das digitale COVID-Zertifikat endete zum 31. Dezember 2023 auch die Ausstellung von COVID-Impfzertifikaten in Deutschland. In diesem Zuge wurden auch die CovPassCheck-App und die CovPass-App eingestellt. Die CovPass-App wurde in einen Walletmodus
versetzt, in welchem die Zertifikate erhalten bleiben. Die Nachverfolgung und die Überprüfung der Echtheit der Zertifikate ist nicht mehr möglich. Im entsprechenden Infobrief des Bundesministeriums für Gesundheit (PDF, 30KB) finden Sie weiterführende Informationen.
Post-COVID-Syndrom
Egal ob sie einen schweren oder leichten Krankheitsverlauf durchlaufen haben: An COVID-19 Erkrankte können auch noch lange Zeit nach ihrer Akutbehandlung an körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen leiden. Betroffen sind Menschen aller Altersgruppen – Kinder und Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen. Aktuelle Studien schätzen, dass circa zehn Prozent der Corona-Patientinnen und -Patienten vom Post-COVID-/Long-COVID-Syndrom betroffen sind.
Weitere Informationen und Anlaufstellen finden Sie auf unserer Unterseite:




